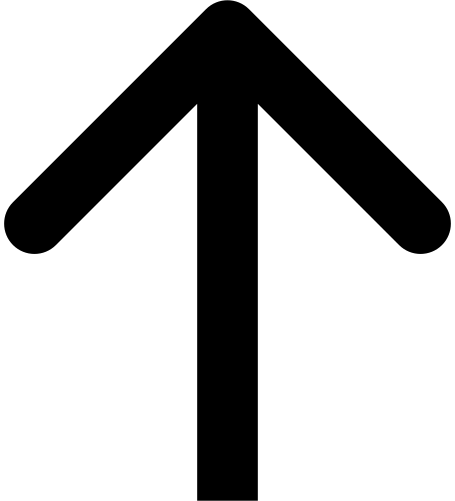Den Roller stelle ich entschuldigend lächelnd drinnen neben dem Eingang ab. Ich weiß, dass ich damit aussehe wie 12, ich weiß, dass sich das Fahren damit unter keinen Umständen als lässig umbewerten lässt. Die restliche Hoffnung, dass es zumindest eigenwillig ist, auf eine Art, die meine Credibility als crazy im besten Sinne erhöht; crazy als Künstlerin who doesn’t give a fuck about regular coolness.
Sie sitzt schon da, ich urteile im Bruchteil einer Sekunde über ihre Coolness, ohne es zu wollen, sie erinnert mich an meine Kunstlehrerin aus der Grundschule. Die 12-jährige Rollerfahrerin und die Grundschullehrerin treffen sich im Café für ein Jobinterview.
Sie lächelt nicht, als ich zu ihr rüber winke, ihr Blick bleibt streng, aber nicht so, dass ich von ihrer Aura eingeschüchtert bin, sondern eher so, dass ich vermute, dass sie selbst angespannt ist. Ich möchte charmant rüber kommen, hab aber heute nicht mehr viel übrig, und bin genervt, dass mein Wunsch, gemocht zu werden, größer ist als der, diese Person wirklich kennenzulernen, um sie dann vielleicht meinerseits sehr zu mögen. (Woran ich arbeite: Dass sich erst mal alle vorstellen können, dass es toll wäre, mit mir zu arbeiten und dann liegt die Entscheidung am Ende in meiner Hand. Die Absagen erteile ich.) Genervt auch davon, dass ich für die Erfüllung meines Wunsches keine andere Strategie habe als mich anzupassen. Ich schaue mir dabei zu, wie ich mich verwandle und immer weniger leiden kann. I am a good girl. Eine, die gemocht wird für ihre Wohlerzogenheit, her dull, friendly interest in anything, die zu allem die Augen in Überraschung und Einvernehmen weitet.
Während sie auf meine Nachfragen eingeht, von denen ich mir vorsorglich neue ausdenke, , noch während sie die vorigen beantwortet, versuche ich wirklich zuzuhören und schraube gleichzeitig an meiner Zuhörerinnenhaltung, die das sichtbar machen soll.
Das lenkt mich ab, zu viele ihrer Sätze verschwinden ungehört, ich bin nicht mehr sicher, was sie gesagt hat, muss sie aber die ganze Zeit aufmerksam angeschaut haben. Meine nächste Frage ein guess – vielleicht hat sie genau darüber schon gesprochen. Vorsorglich formuliere ich im Stil einer Zusammenfassung, rückversichere mich um Vollständigkeit und richtiges Verständnis.
Draußen ist es schon dunkel, drinnen eher grelle Beleuchtung. Ich schaue direkt auf eine Wand, an der eine bis zur Decke reichende geriffelte Holzvertäfelung angebracht ist. Die kleinen Abstände zwischen den einzelnen Brettern machen im Zusammenspiel mit dem Licht, dass es aussieht, als würde die Wand in einer Wellenbewegung auf mich zu kommen. Meine Augen stellen scharf und unscharf auf ihrem Gesicht, rutschen immer wieder ab auf die Wand hinter ihr. Sie anzuschauen, macht mir Kopfschmerzen, das Gespräch, dass wir über ihr Arbeitsleben führen, wird zäher. Ich überlege das ganze Gespräch über, ob ich sie bitten könnte, den Platz zu wechseln.
Merkt sie was? Spürt sie, dass sie mich verloren hat? Glaubt sie überhaupt, mich für sich gewinnen zu müssen? Verändert sich unser Machtverhältnis dadurch, dass sie das Gefühl haben könnte, sie erzählt nicht catchy genug von ihrer Arbeit? Die vierte Gedankenspur neben dem eigentlichen Gespräch, der Arbeit an meiner Zuhörhaltung und der Holzvertäfelung ist die Frage, ob der Kaffee, den sie mir zuvor von der Bar mitgebracht hat, schon bezahlt ist und wenn, ja, ob ich dann eingeladen bin. Ich habe Angst, mich für etwas zu bedanken, was nicht als Geschenk gedacht war. Als die Bar schließt – wir sind schon zum Gehen angezogen – laufe ich mit zu langsamen Schritten, das Portemonnaie sichtbar in der Hand, auf die Bar zu und antizipiere die Stimme, die hinter mir tatsächlich ruft: Der Kaffee ist schon bezahlt!. Mein „Oh danke“ muss sich mit der müden Überraschung in der Stimme entweder gespielt oder undankbar anhören.
Wer hat hier wem was zu bieten? Wodurch erlange ich Macht, wenn ich weiß, dass der Auftrag, der mir angeboten wird, von zahlreichen Menschen genauso gut erledigt werden kann wie von mir?